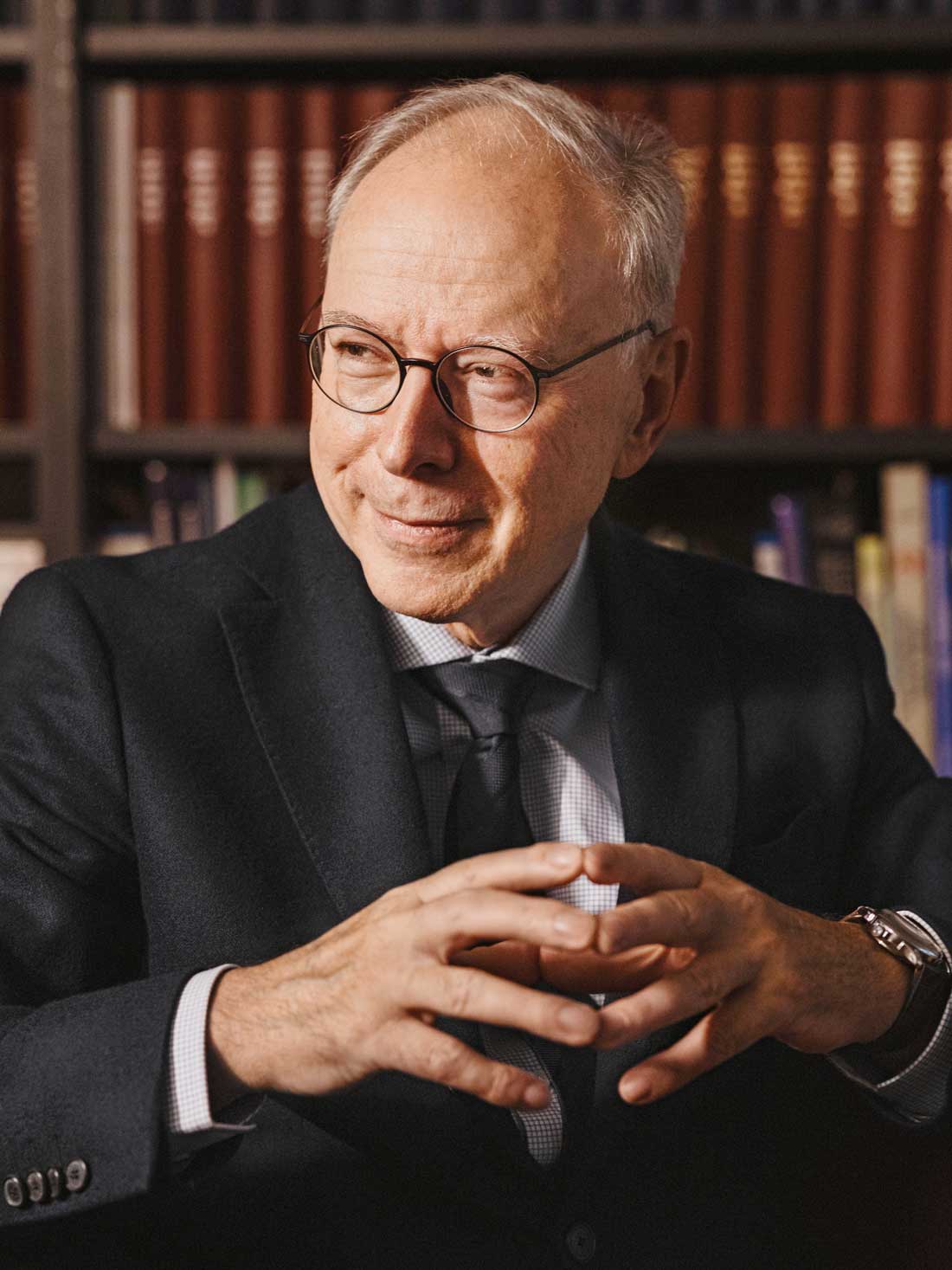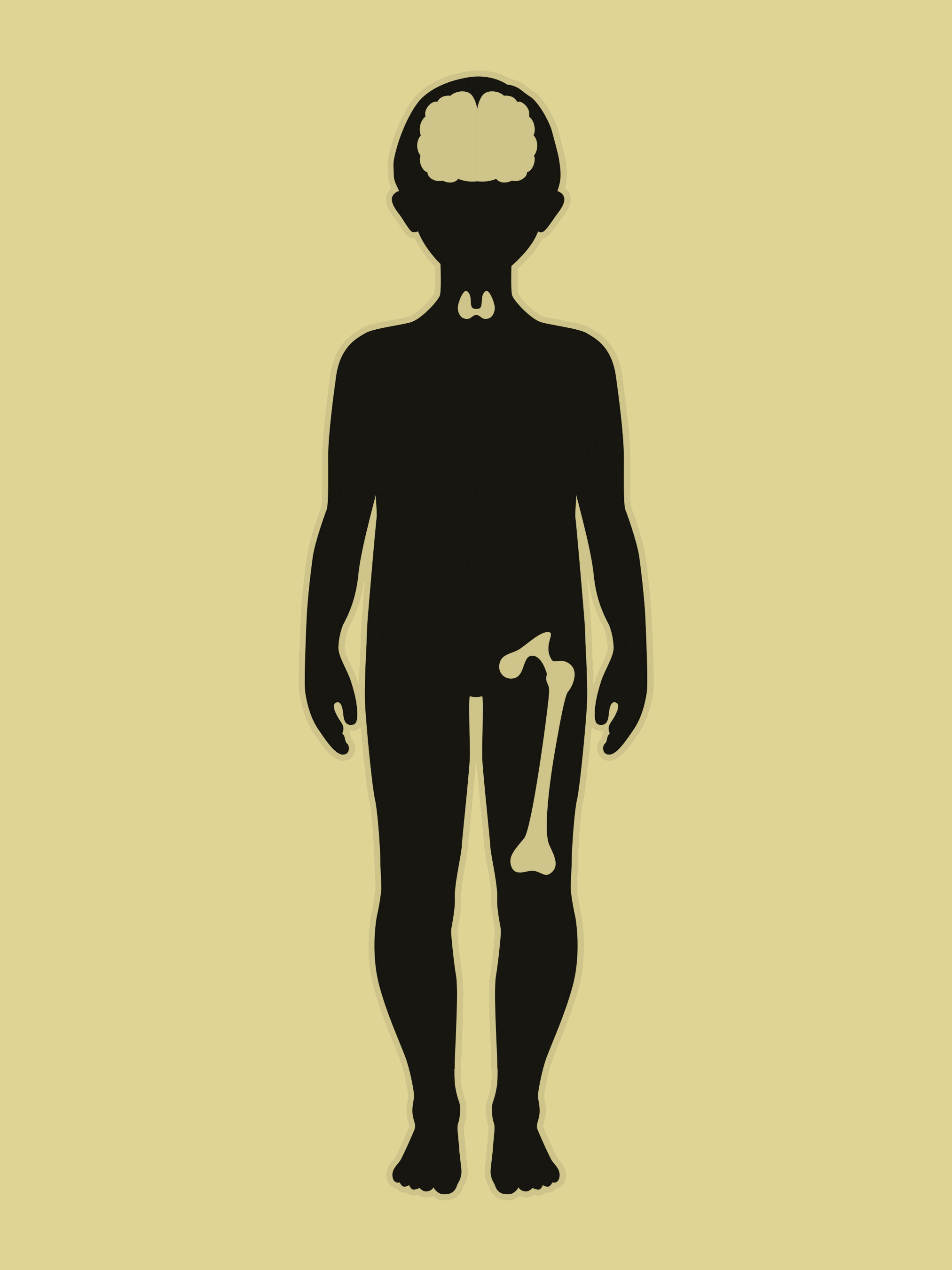Systeme in
Betrieb
Fotos
Simeon Johnke

Die Medizintechnik lebt vom intensiven Austausch zwischen Ingenieuren, Betriebswirtschaftlern und klinischem Personal. Bernhard Hochholdinger (BL) und Norbert Lechner (NL) sprechen mit uns am Kepler Universitätsklinikum im oberösterreichischen Linz über die wachsende Bedeutung der Medizintechnik für Effizienz und Wirtschaftlichkeit von modernen Krankenhäusern.

Magister Hochholdinger, Sie leiten die Medizintechnik der Oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH. Wie kam es dazu?
(BH) 2003 begann ich, für das ehemalige Allgemeine Krankenhaus (AKh) der Stadt Linz als Projektleiter der Medizintechnik zu arbeiten. 13 Jahre später schlossen sich dann das AKh, die Landesfrauen- und Kinderklinik und das Wagner-Jauregg-Krankenhaus zum Kepler Universitätsklinikum (KUK) zusammen. 2017 übernahm ich die Geschäftsbereichsleitung für Medizintechnik und Medizininformatik. Seit der Eingliederung des KUK im Juli 2019 in die Oberösterreichische Gesundheitsholding bin ich mit meinem Team verantwortlich für die Medizintechnik der gesamten Holding.
Welche Rolle spielt die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH in Österreich?
(BH) Die Holding ist mit rund 14.500 Mitarbeitern Oberösterreichs größter Krankenhausträger und betreibt neben dem Kepler Universitätsklinikum fünf weitere Regionalkliniken an acht Klinikstandorten.
Was macht das Kepler Universitätsklinikum aus?
(BH) Mit rund 6.500 Mitarbeitern und circa 1.800 Betten ist das KUK das zweitgrößte Krankenhaus Österreichs, der zentrale Gesundheitsversorger für die Stadt Linz und die gesamte Region. Es deckt das klinische Spektrum durch alle Fachbereiche und Lehrstühle ab. Die enge Verbindung zur medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität ermöglicht neue Lernformen und bietet viele Chancen im Bereich Forschung und Entwicklung. Der Campus-Charakter des Klinikums schafft eine optimale Grundlage für effizientes Arbeiten und Flexibilität. Bis auf den Neuromed Campus, der sich an einem anderen Standort in Linz befindet, sind die Gebäude hier am Med Campus sowohl durch unterirdische Versorgungswege als auch überirdische Gänge miteinander verbunden. Die schmalen Glasgänge zwischen den Gebäuden, die wir intern Löwengänge nennen, sind ein Sinnbild für die Vernetzung.

Herr Lechner, Sie sind ein wichtiger Ansprechpartner für Medizintechnik am KUK. Wie sind Sie in diese Rolle hineingewachsen?
(NL) Nach acht Jahren in einem Unternehmen im Bereich der Röntgentechnik begann ich meine Karriere 1998 im damaligen AKh Linz als ›One-Man-Show‹. Ich startete als erster Röntgentechniker im Haus. Über einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren konnte ich innerhalb der Medizintechnik einen kleinen Bereich mit zwei Mitarbeitern aufbauen, die für alle bildgebenden Verfahren verantwortlich ist. Im Moment betreuen wir den Med Campus mit circa 150 Systemen, von CT- und MR-Anlagen, Angiografie- und Röntgenplätzen bis hin zu Ultraschallgeräten und C-Bögen. Neben der praktischen Arbeit mit den Geräten liegt mir die Lehre sehr am Herzen. Schon lange sind Vorlesungen und Lehrveranstaltungen ein fester Bestandteil meiner Arbeit.
Was sind die Hauptaufgaben in der Abteilung Medizintechnik?
(BH) Die Sicherstellung der Funktions- und Betriebssicherheit aller medizintechnischen Geräte ist eine zentrale Aufgabe. Wir sind verantwortlich für die Budgetsteuerung, Koordination, Durchführung und Überwachung von Wartungen, Reparaturmaßnahmen und sicherheitstechnischen Prüfungen. Aufgrund unserer technischen Expertise sind wir nicht nur Ansprechpartner für medizinisches Personal, sondern auch für den Einkauf der Klinik. Wir sind in den Beschaffungsprozess stark involviert. Darüber hinaus gewinnt die Zusammenarbeit mit der Forschung und Lehre immer mehr an Bedeutung. Die Einführung von neuen Technologien oder die Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung mit Firmen ist für das KUK essenziell.
Wie kann man sich Ihre Tätigkeit konkret in Bezug auf mobile C-Bögen vorstellen?
(NL) Unsere Kernkompetenz liegt zunächst in der Aufrechterhaltung des Betriebs, das heißt dem Reparieren, Instandsetzen sowie Prüfen und Warten der C-Bögen. Hierfür sind wir regelmäßig mit den jeweiligen Herstellern in Kontakt. Was unsere Medizintechnik auszeichnet, ist aber das Fachwissen, das es uns ermöglicht, Arbeiten eigenständig vor Ort durchzuführen. Das hebt uns von anderen Krankenhäusern ab. Außerdem fokussieren wir uns auf die ständige Marktbeobachtung und -analyse, um bei Neuanschaffungen Ärzte und Einkauf kompetent beraten zu können. Wir informieren uns über die neuesten Entwicklungen – Kongresse wie ein RSNA oder ECR gehen an uns nicht spurlos vorüber.
Wie sind Sie in den Entscheidungs- und Kaufprozess für einen mobilen C-Bogen eingebunden?
(BH) Die Medizintechnik ist eine wichtige Stütze für den Krankenhausträger und wird bereits bei der Mittelfristplanung in den Budgetierungsprozess der Klinik involviert. Die Expertise zu Gerätezyklen, Ersatzteilversorgung oder End-of-Life-Daten der Hersteller ist hier notwendig und gewünscht.
Wie läuft ein solcher Entscheidungsprozess ab?
(NL) Eine Neu- oder Ersatzbeschaffung beginnt bei uns immer mit Nutzergesprächen: Im Vorfeld holen wir Feedbacks von Anwendern wie Ärzten, OP-Pflegern, Abteilungs- oder Klinikleitern ein und informieren uns über mögliche Vorlieben. Wir berücksichtigen und diskutieren das Anwendungsgebiet, spezielle Anforderungen und Erfahrungen, aber auch neueste Studien zu Systemen der verschiedenen Hersteller. Mit diesem Wissensstand können wir anschließend eine Auswahl an passenden bildgebenden Systemen zusammenstellen. Auf Basis der Nutzergespräche und Erfahrungswerte wird dann ein Konzept für die Investitionsplanung erstellt und in Zusammenarbeit mit dem Investitionsmanagement und dem Einkauf umgesetzt.
Wo sehen Sie Vorteile in diesem Prozess?
(NL)Unabhängige Berater für Ausschreibungen sind in einem gewissen Maße immer marktgeprägt. Die interne Beratungsexpertise der Medizintechnik im KUK ist essenziell für eine gelungene Investitionsplanung. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Präsenz unserer Abteilung vor Ort. Wir erleben die technische Alterung der Systeme mit: Zuerst erfolgt der Einbindungsprozess der Geräte, zum Beispiel begleitet von Feinjustierungen, bis hin zur problemlosen Nutzung. Später werden Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen erforderlich. Wir sind daher kontinuierlich in Kontakt mit den Pflegern, Ärzten oder Radiologen, die die Geräte bedienen. So können wir die Erfüllung der Anforderungen oder das Handling der Geräte bewerten und dokumentieren.
(BH) Die Beratung, Unterstützung und Konzepterstellung für die Investitionsplanung innerhalb des KUK läuft hervorragend und bietet viele Vorteile. Für uns ist es besonders wichtig, die medizintechnische Expertise in unserem Haus zu halten und zu fördern, um eine bestmögliche Beratung der verschiedenen Fachabteilungen zu gewährleisten. So ist die Aussage von Herrn Lechner bindend für die ganze Holding. In der Unternehmensholding ist die Abteilung Medizintechnik innerhalb der Technischen Direktion der Oberösterreichischen Gesundheitsholding Ansprechpartner für alle maßgeblichen medizintechnischen Fragestellungen. Ziel ist nun, die Erfahrungen und funktionierenden Prozesse des KUK in die Holding einzubringen. Da wir in der Medizintechnik laufend Erfahrungswerte aus den unterschiedlichen Häusern sammeln, können wir direkt passende Geräte zur Beschaffung vorschlagen, unterstützt von einem Leihgeräteprozess zur Testung bei neuen Gerätetypen.
Nach welchen Kriterien wird ein C-Bogen ausgewählt?
(NL) Unsere Beratung ist immer speziell auf den jeweiligen Nutzer und dessen Anwendungsgebiet zugeschnitten. Natürlich achten wir bei der Auswahl eines neuen C-Bogens grundsätzlich auf Kriterien wie eine adäquate Bildqualität, Dosis, Effizienz oder die passende Detektorgröße. Auch Standardisierung über die Fachbereiche hinweg ist dabei notwendig.
(BH) Die neueste Technik ist für uns wichtig. Gerade beschränkte finanzielle oder personelle Ressourcen fordern moderne Technologien und Innovationen, die das Klinikum bestmöglich und über eine lange Lebensdauer unterstützen. Auch hier ist die große Chance im Zusammenschluss der Krankenhäuser zu sehen: Regionalkliniken profitieren von einer Ausstattung mit innovativen Geräten. Die Herausforderung bei der Anschaffung neuer Systeme ist immer auch eine Gratwanderung zwischen der neuesten Technologie und der Ausgereiftheit des Produktes – wir wollen grüne Bananen vermeiden.
Sie haben neben Bildqualität auch die Dosis erwähnt.
Welche Rolle spielt sie im Entscheidungsprozess?
(NL) Dosis hat für uns eine hohe Relevanz. Das KUK ist in Europa führend in der Kinderherz-Diagnostik und -Chirurgie. In diesem hochsensiblen Bereich müssen wir Dosiswerte so niedrig wie nur irgendwie möglich halten. Zwar hat sich die Dosiskurve in den letzten 20 Jahren stetig nach unten entwickelt, die neue CMOS-Detektor-Technologie war dennoch ein markanter und begrüßenswerter Sprung. Um zu gewährleisten, dass wir möglichst dosissparende C-Bögen einsetzen, führen wir hier vor Ort eigene Dosismessungen durch, prüfen beispielsweise verschiedene C-Bögen und vergleichen unsere Messwerte auch mit den Angaben der Hersteller. Dieses Vorgehen unterscheidet unsere Medizintechnikabteilung von vielen anderen Häusern. Wir erweitern so unser Know-how, sind selbst entscheidungsfähig. Wir haben die Möglichkeit, für uns realistische Werte zu messen, die unserem OP-Betrieb und den dort vorherrschenden Anforderungen entsprechen. Letztendlich ist der Faktor Dosis mit-kaufentscheidend und war zum Beispiel in einem konkreten Fall im Bereich Neonatologie das Hauptargument für einen C-Bogen von Ziehm Imaging.
Wie funktioniert die Instandhaltung bzw. Reparatur am KUK?
(NL) Aufgrund der hohen Fachkompetenz übernimmt unsere Abteilung Instandhaltungsarbeiten weitgehend selbst. So können wir schnell und flexibel reagieren. Dadurch werden die Anwender bestmöglich betreut. Um diese Arbeiten ordnungsgemäß durchführen zu können, sind wir entsprechend geschult, beispielsweise auch durch die Ziehm Academy in Nürnberg. Natürlich sind wir auch regelmäßig in Kontakt mit Herstellern wie Ziehm Imaging, zum Beispiel wenn es um Ersatzteile geht. Auch bestehen Wartungsverträge mit Herstellern in unterschiedlichen Ausprägungen. Der Service, und vor allem ein persönlicher Ansprechpartner, sind für uns besonders wichtig. Ziehm Imaging bietet, was wir brauchen: Der Service basiert auf persönlichem Kontakt, die Wege und Reaktionszeiten sind kurz. Das macht uns handlungsfähig und wir können technische Probleme schnell und zuverlässig lösen.
Welche medizintechnischen Trends sehen Sie in der Zukunft?
(BH) Es zeichnen sich immer stärker Trends ab, die die bereichsübergreifenden Schlagworte Flexibilität und Effizienz bedienen. Vor diesem Hintergrund werden mobile, platzsparende Lösungen immer wichtiger. Mit ihnen können Prozessabläufe auch vor einem wirtschaftlichen Hintergrund optimal für Patienten und klinisches Personal gestaltet werden. Wesentliche Verbesserungen im Bereich Software werden zukünftig die Diagnostik und Behandlung verändern und unterstützen. Funktionen der Systeme, die wir aktuell aus Zeitgründen nicht manuell konfigurieren und optimal verwenden können, werden immer mehr mit Hilfe automatischer Voreinstellungen vereinfacht. Roboterassistierende Chirurgie wird verstärkt kommen: In Zukunft wird das Zusammenspiel mit innovativen Geräten im Alltag möglich und notwendig sein. Und auch die künstliche Intelligenz dürfte in der Medizintechnik einiges vorantreiben. Dieser stark wachsende Bereich wird vor allem in der bildgebenden Diagnostik eine große Rolle spielen.
Was bedeutet das im Hinblick auf mobile C-Bögen?
(BH) Gegenwärtig sind stationäre Anlagen verglichen mit mobilen C-Bögen beispielweise bei Herzoperationen in der Überzahl – noch! Früher waren die Fixanlagen führend, heute besteht kaum mehr ein Unterschied zu den mobilen Systemen. Lösungen wie die von Ziehm Imaging liefern eine vergleichbare Bildqualität und bieten bei großem Druck zur Effizienz zusätzliche Vorteile wie eine optimale Ausnutzung des OPs, die Nutzung von Hybrid-OPs und die Möglichkeit, multidisziplinäre sowie intraoperative Eingriffe durchzuführen. Künftig wird man flexibler arbeiten und häufiger zwischen den Operationssälen wechseln müssen. Aus diesem Grund wird der Trend ganz klar zu mobilen Geräten gehen. Speziell in der Anwendung der C-Bögen gewinnt die intraoperative Navigation mit 3D-Bildern immer mehr an Bedeutung. Die Möglichkeit, verschiedenste Modalitäten zusammen darzustellen sowie die Einblendung der Instrumenten-Navigation sind zukunftsweisend.
(NL) Ein zusätzlicher, sich klar abzeichnender Trend geht zu C-Bögen ohne Monitorwagen, wie dem Ziehm Solo FD. Mit Hilfe von Videoverteilern ist es mittlerweile möglich, das Bild verlustfrei und kabellos auf jeden Monitor im Raum zu übertragen. Die wichtigen Informationen sind so für Ärzte und Helfer sichtbar, und wir haben gleichzeitig ein störendes Gerät weniger im Operationssaal.
Medizintechnik heute und in der Zukunft:
Was macht Ihren Beruf aus?
(NL) Technologien können nirgends sinnvoller eingesetzt werden als im Feld der Medizin, davon bin ich überzeugt. Unsere Arbeit ist hochinnovativ, es herrscht kaum Routine. Auch die Wissensvermittlung ist abwechslungsreich und für uns eine wichtige Grundlage, um für die Zukunft junge Medizintechniker auszubilden.
(BH) Technische Innovationsschübe und Digitalisierung schaffen eine neue Arbeitsumgebung. In diesem dynamischen Umfeld sehe ich die Möglichkeit, Potenziale der Holding auszubauen und Chancen des Zusammenschlusses für die Medizintechnik zu nutzen. Für mich ist es reizvoll, am Puls der Zeit zu arbeiten und die Zukunft aktiv mitgestalten zu können.

Weitere Informationen zum Kepler Universitätsklinikum
Dieses Interview wurde veröffentlicht in Heft 4 (2020).
Download Heft 4 als pdf